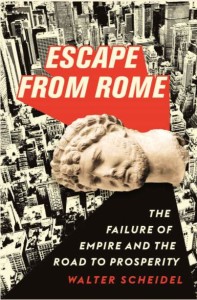 Der in Stanford lehrende Althistoriker Walter Scheidel, der vor fast drei Jahren über die ultimativen Social Justice Warriors Pest, Krieg und Hungersnot publiziert hat, hat sich wieder über die Grenze zur Universalhistorie verirrt und über die gelungene Flucht des Abendlandes vor dem Römischen Reich geschrieben. Mit Escape from Rome wird der aus Wien stammende Akademiker gut ein Dutzend intellektueller Subkulturen gegen sich aufbringen – von zeitgenössischen Winckelmännern bis zu den Fanboys (und -girls) der EU.
Der in Stanford lehrende Althistoriker Walter Scheidel, der vor fast drei Jahren über die ultimativen Social Justice Warriors Pest, Krieg und Hungersnot publiziert hat, hat sich wieder über die Grenze zur Universalhistorie verirrt und über die gelungene Flucht des Abendlandes vor dem Römischen Reich geschrieben. Mit Escape from Rome wird der aus Wien stammende Akademiker gut ein Dutzend intellektueller Subkulturen gegen sich aufbringen – von zeitgenössischen Winckelmännern bis zu den Fanboys (und -girls) der EU.
Imperien, erläutert Walter Scheidel auch mit Seitenblick auf das alte China, böten zwar inneren Frieden, große Wirtschaftsräume, Infrastruktur und “niedrige Transaktionskosten”, hemmten, modern ausgedrückt, jedoch Entrepreneurship und Innovation.
Und sie ließen zwar Wachstum zu – aber eben kein “transformatives” wie jenes der (Ersten) Industriellen Revolution.
Insofern bedeutet “Escape from Rome” ein Abgehen vom einem imperialen Schema, das große Teile Ost- und Südasiens, aber auch des Nahen Ostens und Nordafrikas geprägt hat.
Es ist der Ausbruch Westeuropas (und seiner Nachfolger) aus “Unwissenheit, Krankheit und Unterdrückung”, wie der Historiker schreibt,
eine “Flucht”, die im Narrativ der Aufklärung üblicherweise der modernen, wissenschaftlich orientierten, glaubens- und aberglaubenslosen Welt zugeordnet wird (wie dieser Blogger sagt).
Das Feindbild von Renaissance-Menschen und Aufklärern war “das Mittelalter” und ihre verklärten Orientierungspunkte waren die antiken europäischen Kulturen, das republikanische und kaiserliche Rom inklusive.
Not so, sagt Scheidel. Rom, der Fokus seines Berufslebens, sei eigentlich die Antithese einer dynamischen Gesellschaft.
Beharrende Großreiche
Empires brächten letztlich großräumige und lange anhaltende Stagnation mit sich.
Das Mittelalter mit seiner hartnäckigen Imperial-Resistenz gehört demnach eher zur Vorgeschichte der (modernen, “zweiten”) Great Divergence, eben wegen dessen relativer Kleinräumigkeit, der feudalen Zerrissenheit, der politischen Zersplitterung und der intensiven Eliten-Konkurrenz.
(der Autor scheint konkret freilich lieber an umtriebige italienische Handelsrepubliken, früh industrialisierte Grafschaften und andere reformorientierte Herrschaftsverbände zu denken).
Aus seiner Perspektive ist das Alte Rom durchaus mit den Imperien in anderen Erdteilen vergleichbar.
Rom ist im europäischen Rahmen zwar eine Anomalie, sonst aber ziemlich normal, verglichen mit Han-China, den vorislamischen Perser-Reichen, den Nach-Mohammedanischen Kalifaten und den Osmanen.
Als Westrom im 5. Jahrhundert kollabierte, habe es nur getan, wozu alle Großreiche früher oder später verdammt seien – es sei gestorben.
Die Frage sei eher, warum es in Europa keine erfolgreiche Wiederkehr in der einen oder anderen Form gegeben habe,
eine “Renaissance”, die nicht etwa “edle Einfalt, schlichte Größe” zurück gebracht hätte, sondern Despotie und miefigen Traditionalismus, über viele Jahrhunderte hinweg (wie sich dieser Blogger zu paraphrasieren erlaubt).
Scheidel diskutiert acht historische Augenblicke, in denen eine (Wieder)Vereinigung des Kontinents möglich zu sein schien (bis zur zweiten Great Divergence),
beginnend bei Restaurations- und Rückeroberungsversuchen oströmischer Kaiser im sechsten Jahrhundert und endend bei Napoleon
- in keinem Fall aber war im westlichsten Zipfel der eurasischen Landmasse die Neuauflage eines hegemonialen Empires in den Karten, wenigstens nicht als “robustes Phänomen”.
Eine europäische Einigung, die mit Rom vergleichbar sei, sei – im Gegenteil – immer unwahrscheinlicher geworden, urteilt Scheidel.
Polyzentrismus und kompetitive Fragmentierung blieben – und bleiben bis heute – das Kennzeichen des Alten Kontinents und seiner “Ableger”.
Das ist ein großartiger Gesichtspunkt, Prof. Scheidel.
Latein, ein Einwand
Nun lassen sich leicht Umstände vorstellen, in denen extreme Zersplitterung tatsächlich zu Stagnation führt – wirtschaftlich, technologisch und intellektuell (das Narrativ der Aufklärung und eines gewissen neuzeitlichen Liberalismus ist da nicht so realitätsfremd) –
wenn nämlich “alle im eigenen Saft schmoren”, gute Ideen anderer nicht zur Kenntnis nehmen (können) und inkrementelle kognitive Leistungen damit im Vorhinein unterbunden werden.
Eine solche Situation stellte sich trotz politischer und (später) konfessioneller Zersplitterung nicht in Europa ein und der Hauptgrund dafür war sehr wohl ein Erbe des Römischen Reichs.
Scheidel betont das nicht so stark, vielleicht, weil es seiner Hauptthese zu widersprechen scheint.
Latein ist in seiner Welt eher der Kirche zugeordnet, die er nicht als “spaltendes, modernisierendes”, sondern als “vereinheitlichendes, konservatives” Element wahrnimmt.
Wäre es unter den Karolingern, den deutschen Kaisern, den Habsburgern oder den französischen Königen zu einer europäischen Einigung gekommen, behauptet dieser Blogger, wären die Kirche und das von ihr favorisierte Hochlateinische die ersten Beiträger des neuen Reichs gewesen.
Auch der wiederholte Hinweis auf die aus dem Lateinischen abgeleiteten “vernakularen” Sprachen trägt nicht weit.
Erstens sind die für die frühe Neuzeit in Frage kommenden Idiome Spanisch, Italienisch und Französisch romanisch und als solche der “römischen Ursprache” ziemlich ähnlich;
und zweitens – und wohl gewichtiger - fungierte Latein wenigstens bis ins 19. Jahrhundert als gemeinsame Sprache jener Gelehrtengemeinde, die die kognitiven Grundlagen für den “Takeoff” der (zweiten) Großen Divergenz gelegt hat.
Zugespitzt ausgedrückt: Ohne Latein keine “kopernikanische Wende” und keine naturwissenschaftlichen Fortschritte zum Beispiel in Medizin, Optik, Mechanik, etc.
Latein war, wie bekannt, schon im Mittelalter das kommunikative Bindeglied mehr oder weniger mobiler Eliten, die gemeinsame Sprache von Klerikern, Akademikern, Künstlern und wohl auch Kaufleuten.
Es war der vielleicht wichtigste Katalysator, der die Scheidelsche Fragmentierung erst produktiv und kompetitiv machte.
Dieser Blogger sagt: Erst die von Rom ererbte lingua franca und der erbarmungslose Wettbewerb der Eliten erzeugten den Treibsatz für den Ausbruch aus der Malthusianischen Zwickmühle, die bis dahin die gesamte Menschheitsgeschichte bestimmt hatte.
Der eigentliche Ausbruch, die “Reise in die Prosperität”, fand erst im 19. Jahrhundert statt, parallel zur und wahrscheinlich im kausalen Zusammenhang mit der Verwendung von fossilen Treibstoffen (sagt dieser Blogger).
Kohle, ein zweiter Einwand
Im 19. Jahrhundert freilich ist die Mission unseres Polyhistors bereits beendet. Steinkohle, Lokomotiven und Eisenerzeugung interessieren den Mann aus Wien und San Francisco nicht.
Diese Themen haben bereits Generationen von Wirtschafts- und Sozialhistorikern vor ihm abgegrast (überhaupt handelt es sich nicht um die “angestammte Expertise” des Althistorikers).
Und so gewichtig die gewissermaßen institutionengeschichtlichen Einwände Scheidels auch sind (und die “europäische Latinität”) - ohne Kohle wäre im 19. Jahrhundert tote Hose gewesen (wie später ohne Öl und Gas).
Gewiss, die Kohle wurde nicht im 19. Jahrhundert “erfunden”, die lag schon seit Äonen im Boden
- und natürlich bedurfte es wissenschaftlicher und unternehmerischer “human action” um diese für die biophysikalische Produktion nutzbar zu machen.
Aber erst sie und ihre fossilen Nachfolger ermöglichten jenen Wendepunkt, der die lange Stange der sozioökonomischen Entwicklung zum Hockey-Schläger machte – sagt dieser Blogger. ![]()
Walter Scheidel, Escape from Rome. The Failure of Empire and the Road to Prosperity.2019
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.